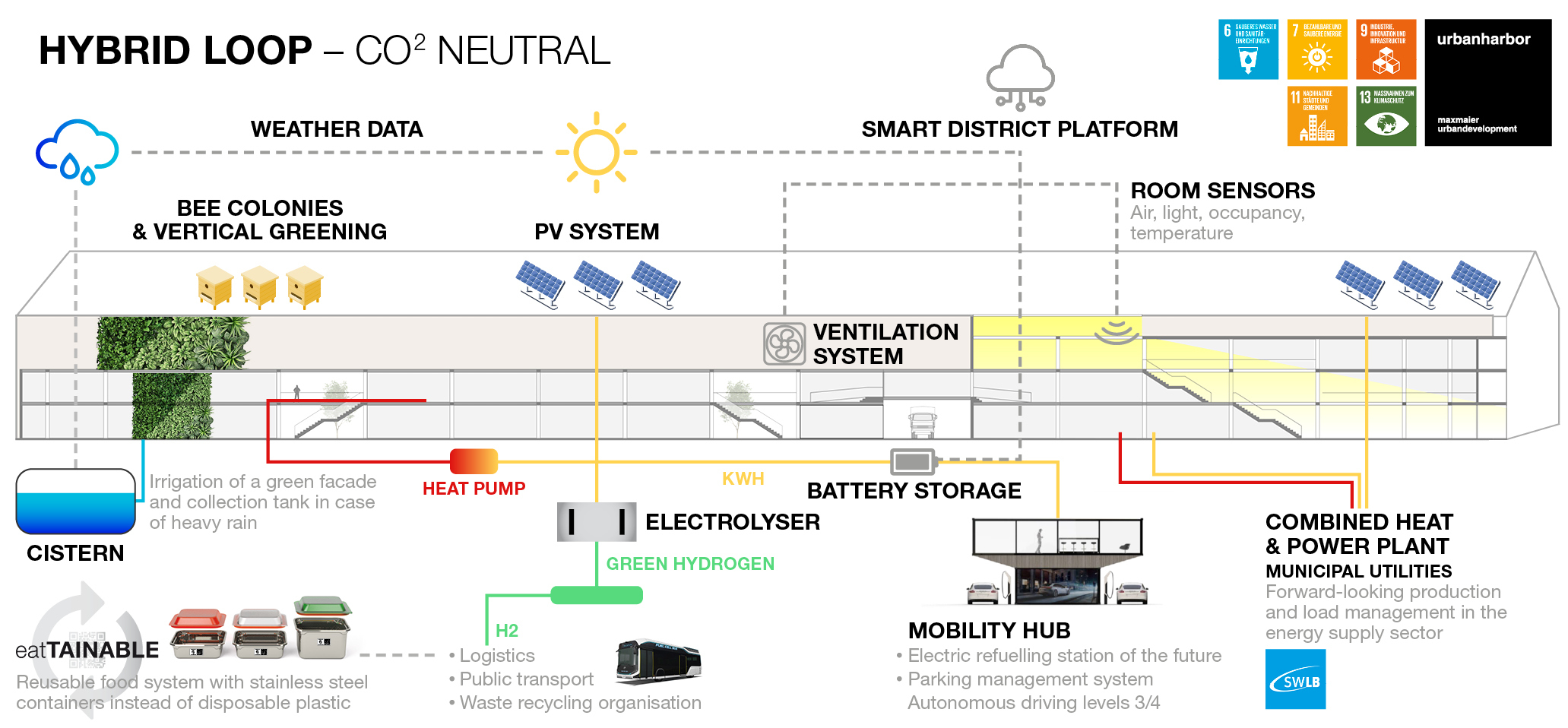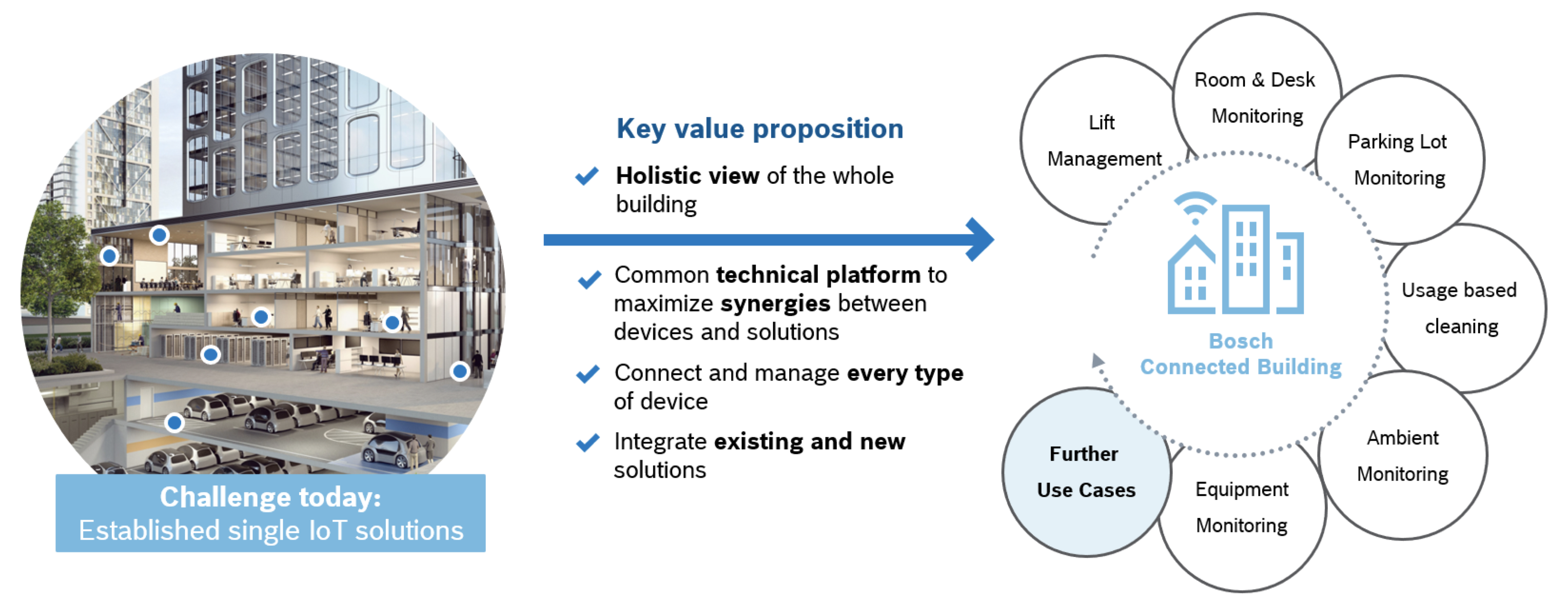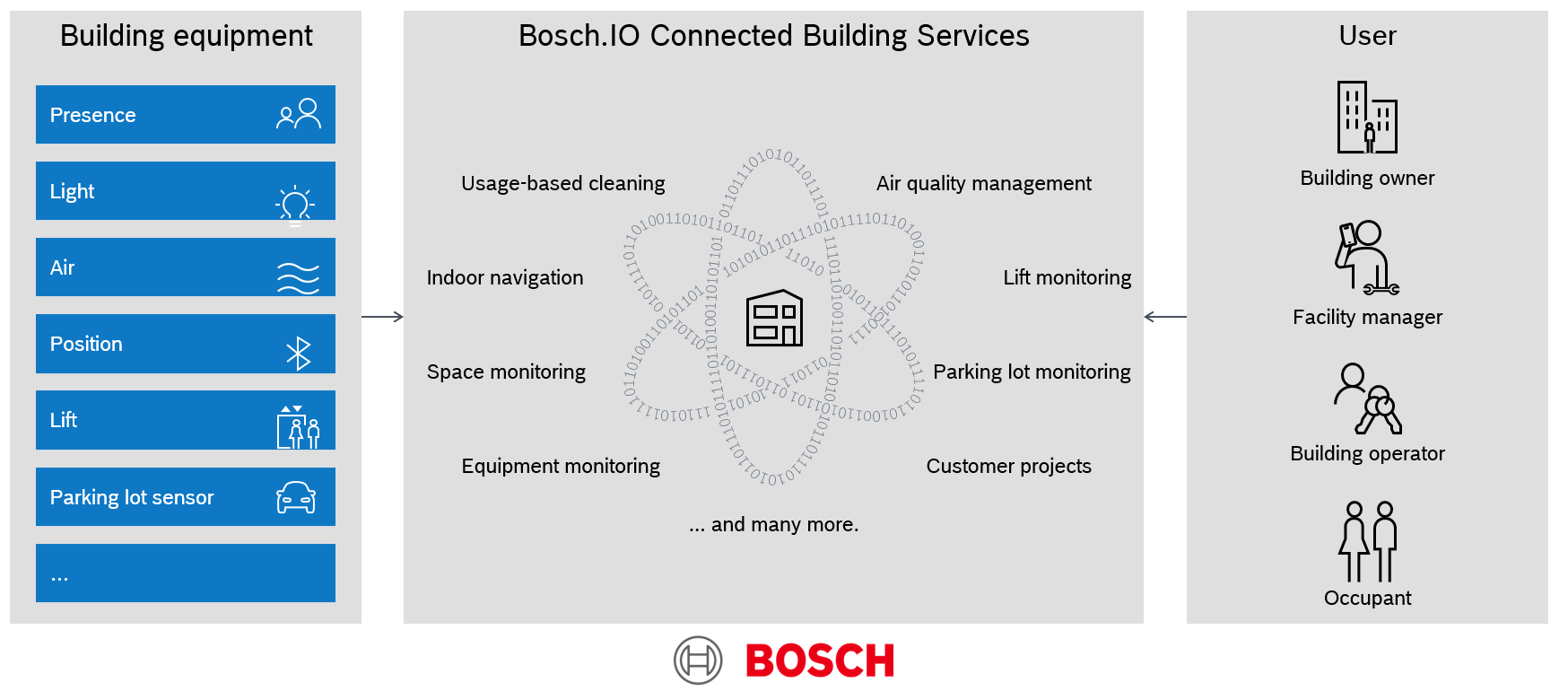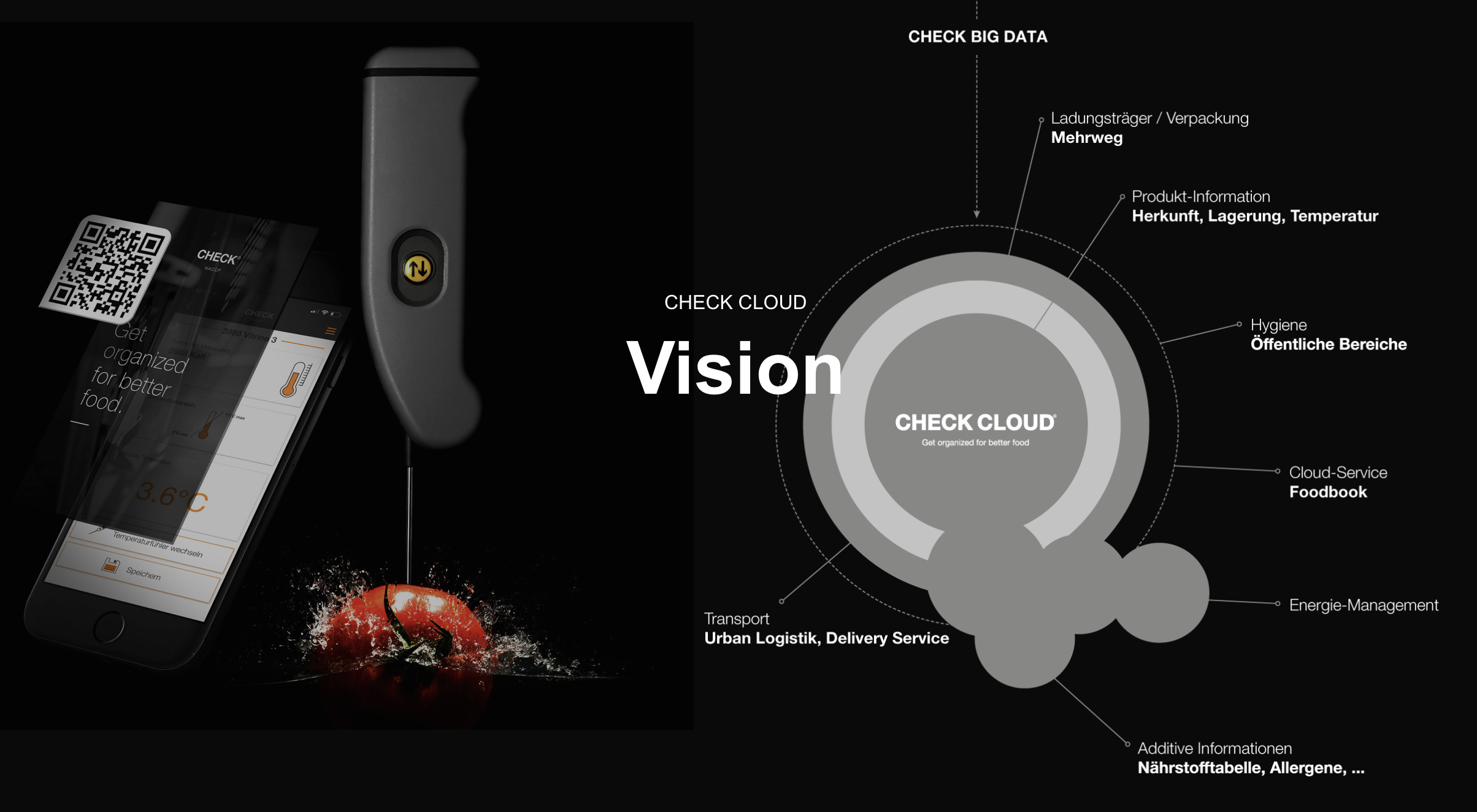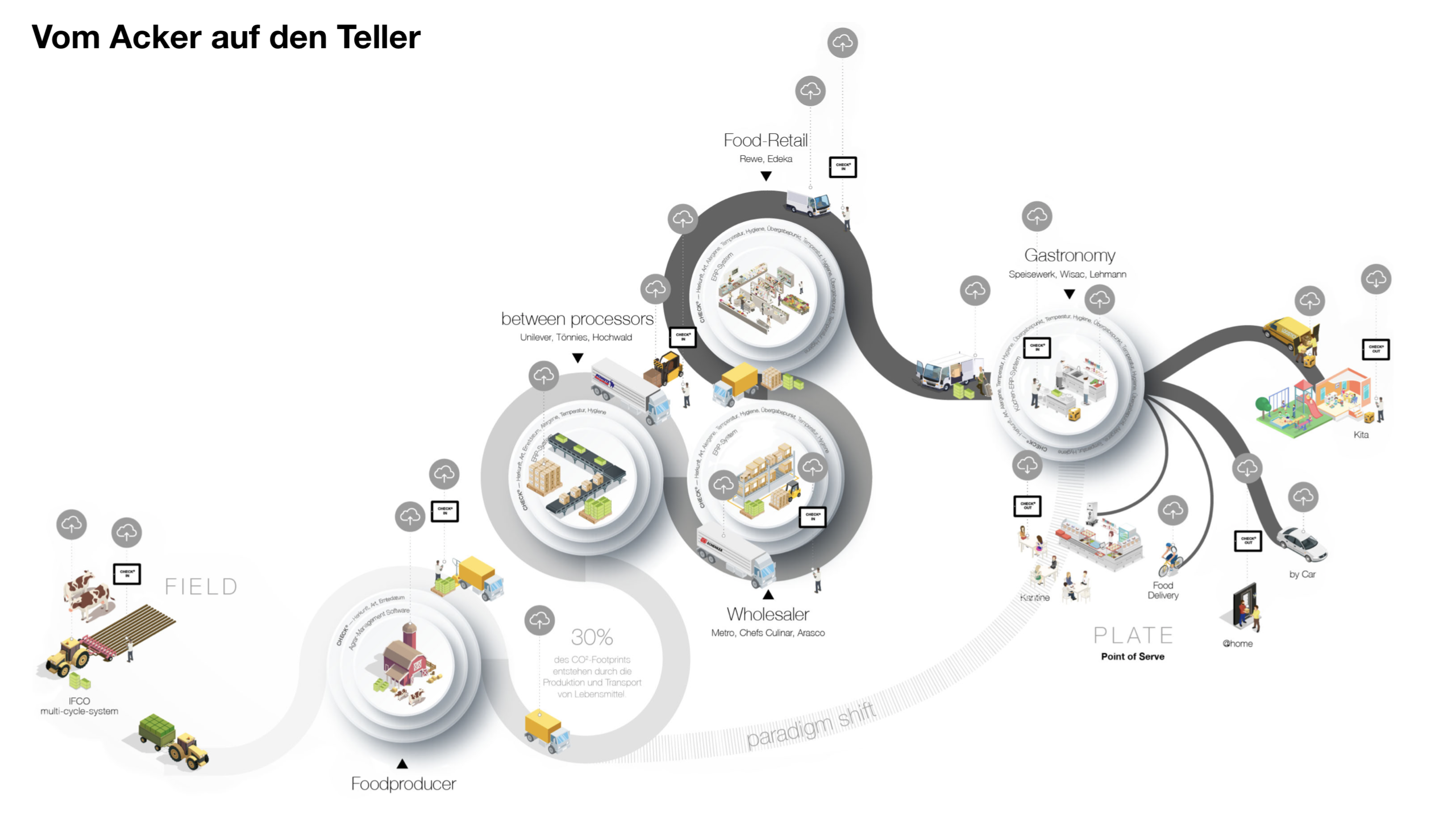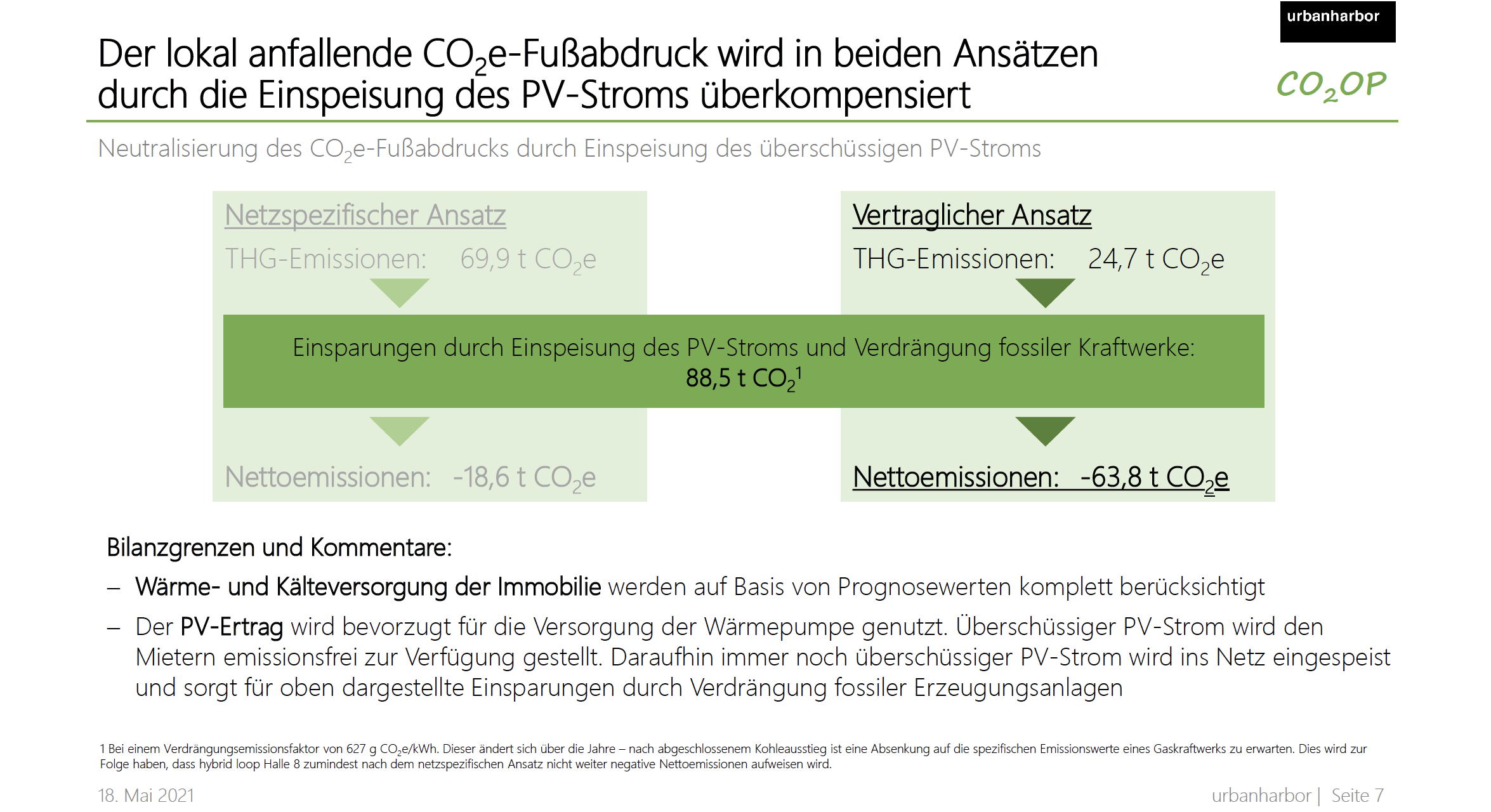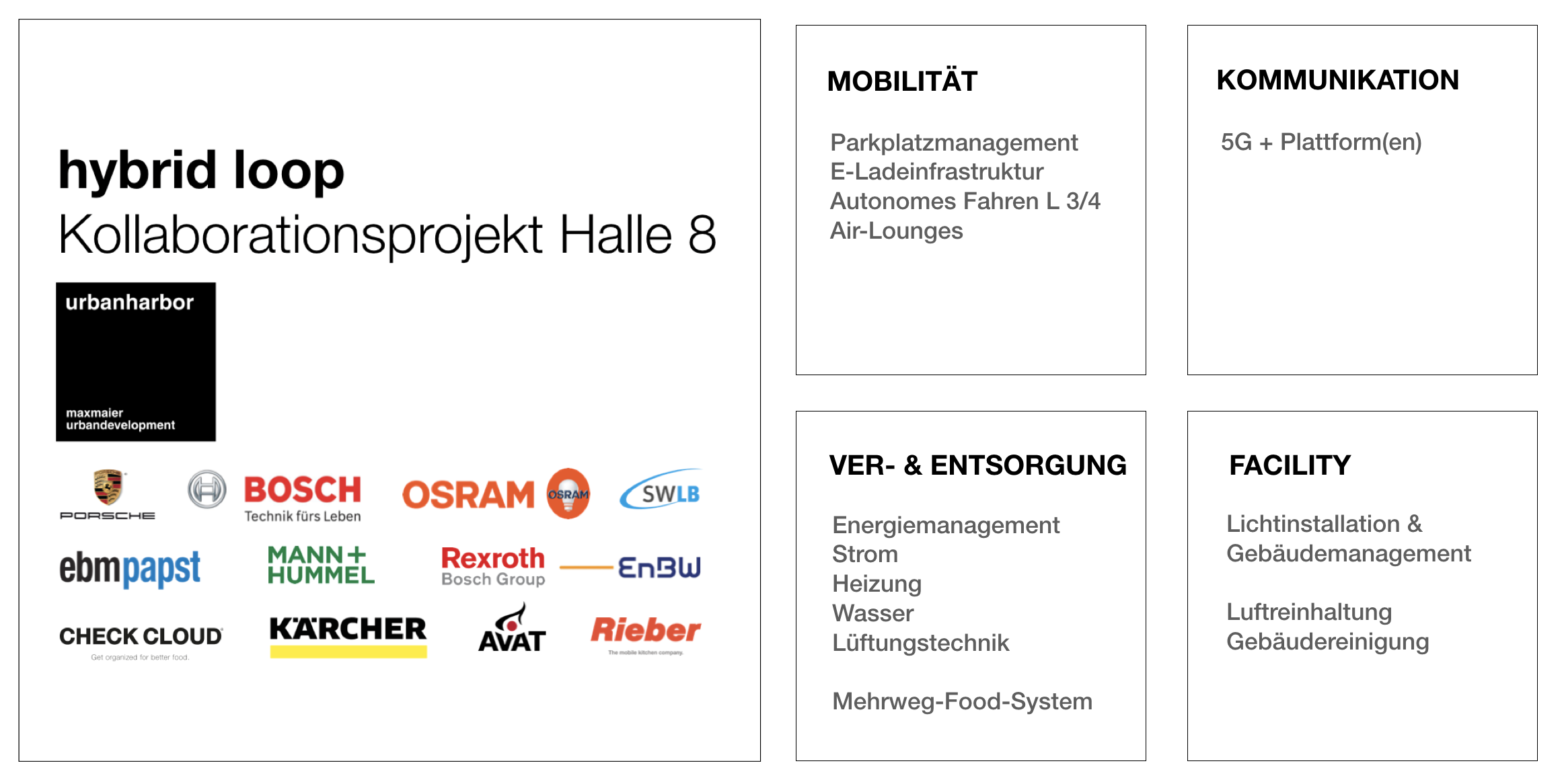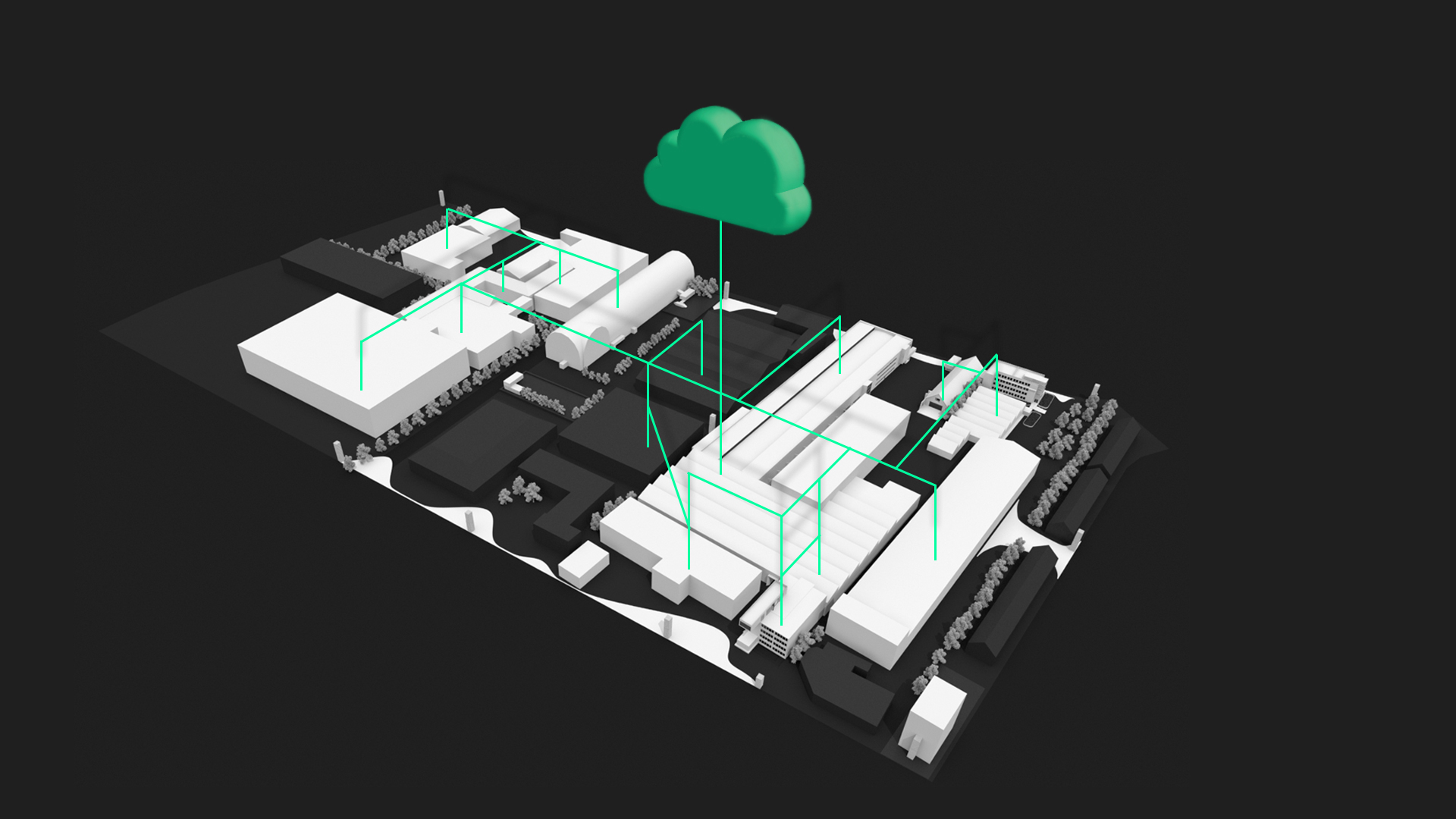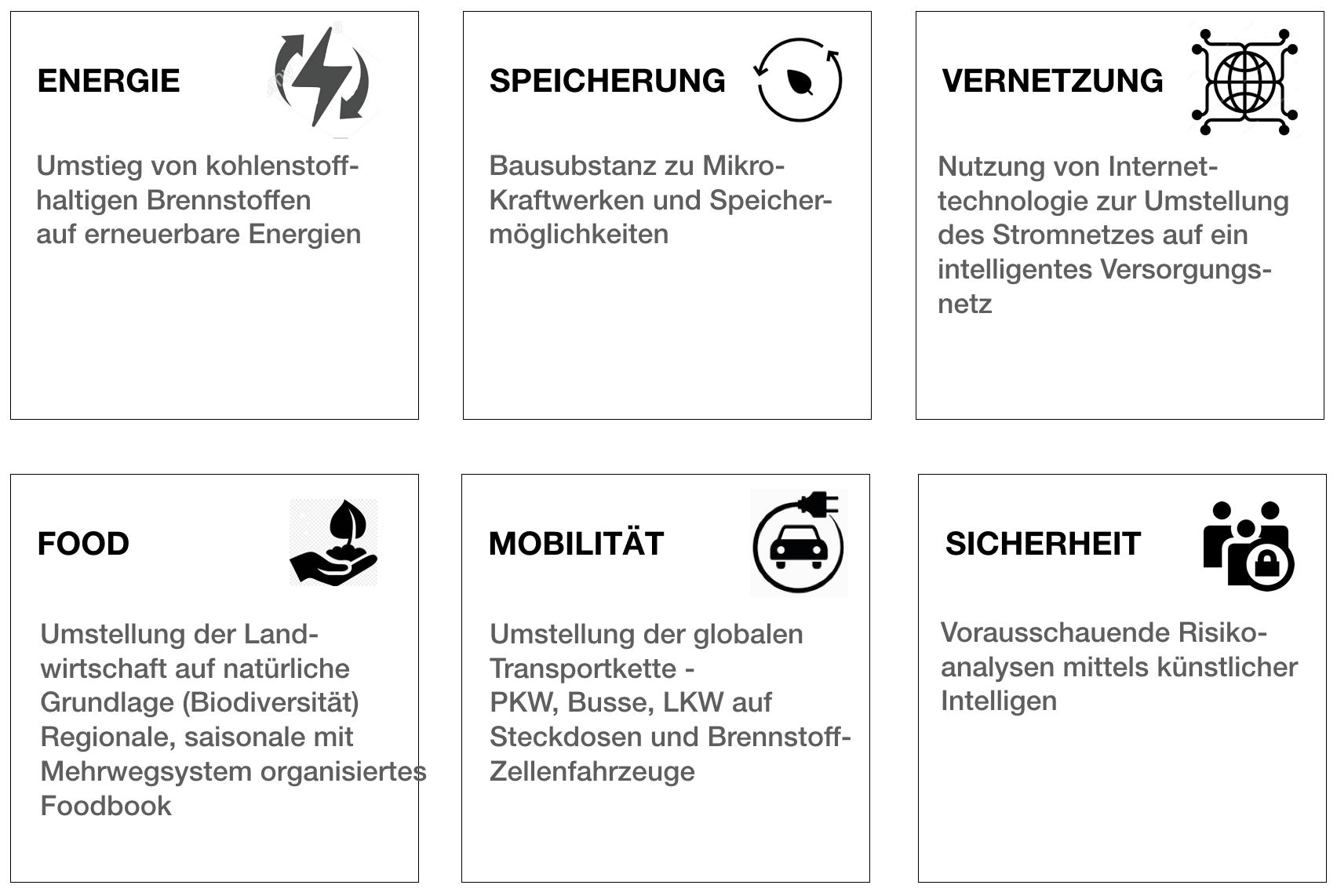PODCAST Farbspiel | Zukunftsideen entstehen im urbanharbor
#32 Zukunftsideen entstehen im urbanharbor – mit Madlen Maier
In Folge 32 von „Farbspiel – der Podcast über Design & Schönheit“ besucht Podcast-Host Dominik Hoffmann in Ludwigsburg Madlen Maier. Sie ist Gesellschafterin in der familiengeführten maxmaier® businessgroup, die sich in drei Geschäftsbereiche aufteilt, mit welchen die Familie gemeinsam nachhaltige Synergien entwickelt. Neben der Rieber GmbH & Co. KG und CHECK CLOUD gehört dazu das rund 200.000 m2 große Industrieareal urbanharbor mit einer CO2-neutralen Immobilienentwicklung und -transformation in der Weststadt von Ludwigsburg.
Die Themen:
urbanharbor als Plattformlösung | Wie arbeiten wir? Wie leben wir? Wie essen wir? | Designpreis für den hybrid loop | Was Porsche im urbanharbor macht | Standortfrage | Architektur folgt der Funktionalität | Freiraum und Fehlerkultur
LINKS ZUM REINHÖREN
🎧 Podigee: https://farbspiel.podigee.io/32-zukunftsideen-entstehen-im-urbanharbor-mit-madlen-maier
🎧 Spotify: https://open.spotify.com/episode/2Mq5fXXrIuxEG4GMesMGG9?si=KkM0ZtfkTM60Oq6ldOQvfQ
🎧 Wir Machen Druck: https://www.wir-machen-druck.de/podcast-farbspiel.html
Vielen Dank an Dominik Hoffmann Host des Podcast Farbspiel
& Uli Geyer, Manuel Schmiedecke und
Dominik Winter von WIRmachenDRUCK
Your consent is required to display this content from vimeo - Privacy Settings
Your consent is required to display this content from vimeo - Privacy Settings
we capture more CO2 in our real-estate than we emit
t CO2 e/a
Ersparnis durch überschüssigen PV-Strom (hybrid loop | bilianziell für ein Gebäude erfasst)
you have to plant 5040 trees to compansate 63 t CO2 e / year
Kompensation CO2 Natur
Um eine Tonne CO2 aufnehmen zu können, muss die Buche etwa 80 Jahre wachsen. Das heißt: Pro Jahr bindet die Buche 12,5 Kilogramm CO2. Sie müssten also 80 Bäume pflanzen, um jährlich eine Tonne CO2 durch Bäume wieder zu kompensieren.